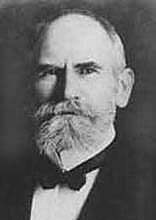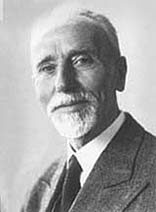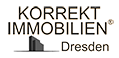|
Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/stadtgeschichte/personen/dresdner-wissenschaftler.php 16.09.2021 15:36:16 Uhr 05.06.2025 08:03:33 Uhr |
|
Wissenschaftler
Johann Friedrich Böttger
1701 traf der »Goldmacher«, geboren am 4.2.1682 in Schleiz, mit militärischer Bewachung von Wittenberg kommend »unter größter Heimlichkeit« erstmalig in Dresden ein.
Sein erstes Quartier war das Goldhaus im Schloss. Nach mehreren Umzügen wagte er 1703 die Flucht, wurde gefasst und auf dem Königstein inhaftiert.
1707 verlegte man sein Laboratorium auf die Jungfernbastei in der Dresdner Stadtbefestigung. Hier gelang ihm ein Jahr später gemeinsam mit Ehrenfried Walter von Tschirnhaus die Erfindung des ersten europäischen Hartporzellans.
In Dresden machte sich Böttger auch als Botaniker einen Namen. Er legte ein Gewächshaus mit über 400 seltenen Pflanzen an.
Im Jahre 1710 erfolgte seine Berufung als Administrator der Porzellanmanufaktur nach Meißen.
Nach seiner Freilassung 1714 bewohnte er bis zu seinem Tode ein Stadthaus auf der Schießgasse.
Carl Gustav Carus
war Arzt, Maler und Naturphilosoph. Er wurde am 3.1.1789 in Leipzig geboren und studierte dort Medizin, Philosophie und Naturwissenschaften.
Nach Dresden kam er 1814 – als Professor für Geburtshilfe an die Chirurgisch-Medizinische Akademie und als Direktor der königlichen Hebammenschule.
1827 stieg er zum königlichen Leibarzt auf und erhielt zugleich den Titel eines Hof- und Medizinalrates. Doch sein Einfluss auf die Wissenschaft und das Geistesleben erstreckte sich noch weit über Dresden hinaus.
Carus gehörte zum Romantikerkreis um Ludwig Tieck. Er stand im Briefwechsel mit Alexander von Humboldt und Johann Wolfgang Goethe.
Unter dem Einfluss seines Freundes und Mentors Caspar David Friedrich beschäftigte er sich mit der Malerei und kann heute als einer der namhaftesten Landschaftsmaler gesehen werden.
Carus veröffentlichte circa 200 Schriften, die zu ihrer Zeit bedeutsam waren. Die vergleichende Anatomie wurde von Carus erstmals in Deutschland als eigenständiges Fach gesehen und seine naturphilosophischen Schriften, von romantischem Denken geprägt, tragen ihren Wert bis in die Gegenwart.
Die »Neun Briefe über Landschaftsmalerei« (1831) sowie die »Betrachtungen und Gedanken vor auserwählten Bildern der Dresdner Galerien« (1867) spiegeln seine Kunstauffassung wider.
Wilhelm Gotthelf Lohrmann
Geodät, Astronom, geboren am 31.1.1796 in Dresden, gestorben 20.2.1840 in Dresden. Lohrmann wurde nach Architekturstudium und Arbeiten im geodätischen Dienst 1825 Leiter der trigonometrischen Katastervermessung.
Im Jahre 1835 war er Vorsteher der Technischen Bildungsanstalt in Dresden.
Gemeinsam mit Johann Andreas Schubert gründete er den Dresdner Gewerbeverein. Lohrmann gab 1824 die »Topografie der sichtbaren Mondoberfläche« heraus und fertigte Karten des Erdtrabanten.
Friedrich Wilhelm Enzmann
Mechaniker, Optiker, geboren am 27.1.1802 in Großpöhla, gestorben 13.2.1866 in Dresden. Enzmann befasste sich gemeinsam mit seinem Bruder mit dem Bau und der Entwicklung fotografischer Apparate.
Im Jahre 1839 bot er als erster Produzent außerhalb Frankreichs Kameras und fotografische Platten mit quadratischem Aufnahmeformat an. Seine Werbeanzeige am 31.Oktober 1839 im »Dresdner Stadtanzeiger« darf als Geburtsurkunde der Dresdner Fotoindustrie gelten.
Johann Andreas Schubert
Techniker, Hochschullehrer, geboren am 18. März 1808 in Wernesgrün/Vogtland, gestorben am 6. Oktober 1870 in seinem Haus an der Friedrichstraße in Dresden-Friedrichstadt. Schubert studierte Architektur und wurde 1828 als Lehrer, 1832 als Professor an die Technische Bildungsanstalt in Dresden berufen. 40 Jahre lang bildete er Techniker aus.
Das Gründungsmitglied der Elbe-Dampfschiff-Gesellschaft war maßgeblich am Bau der »Königin Maria« beteiligt, dem ersten Personendampfschiff auf der Oberelbe. Auch der Bau der ersten deutschen Lokomotive »Saxonia« ist eng mit Schuberts Namen verbunden. Auf dem Führerstand der »Saxonia« nahm er am 8. April 1839 an der Eröffnungsfahrt der Leipzig–Dresdner Eisenbahn, der ersten Fernbahn Deutschlands, teil.
Er berechnete die Eisenbahnviadukte über das Göltzsch- und Elstertal. 1865 wurde er zum Regierungsrat ernannt.
Oskar Drude
Der Botaniker Drude wurde am 5.6.1852 in Braunschweig geboren. Nach seinem Studium in Göttingen wurde er als Direktor des Botanischen Gartens und Professor für Botanik an die Technische Hochschule nach Dresden berufen.
Er verfasste zahlreiche Standardwerke über Pflanzengeografie und -ökologie.
Seine Lehrveranstaltungen an der Technische Hochschule waren ihrer Zeit weit voraus. Drudes Hauptwerk ist die Neuanlage des Botanischen Gartens in Dresden und der Aufbau einer Pflanzenphysiologischen Versuchsstation.
Am 1.2.1933 starb Drude in Dresden.
Karl August Lingner
war Industrieller und Sozialhygieniker. Der am 21.12.1861 in Magdeburg geborene Lingner gründete im Jahre 1888 mit dem Ingenieur Kraft in Dresden einen Kleinbetrieb für Haushaltsartikel und 1893 sein chemisches Labor.
Hier entwickelte er das Mundwasser »Odol« in der bekannten Seitenhalsflasche. Er startete mit den Odol-Luftschiffen eine großangelegte Werbekampange und sorgte so für die weltweite Verbreitung des Mundwassers.
Daneben erwarb sich Lingner große Verdienste auf dem Gebiet der Volksgesundheit. Er gründete 1898 mit dem Mediziner Schlossmann eine der ersten deutschen Säuglingsstationen, 1900 die Zentralstelle für Zahnhygiene und 1901 eine Desinfektionsanstalt.
Der erfolgreiche Industrielle war der Initiator der 1. Internationalen Hygiene-Ausstellung im Jahre 1911 und förderte durch eine Stiftung die Errichtung eines »National-Hygiene-Museums« in Dresden 1930.
Heinrich Barkhausen
Physiker, geboren am 2.12.1881 in Bremen, gestorben am 20.2.1956 in Dresden. Barkhausen wurde 1911 als einer der jüngsten Professoren an die Technische Hochschule Dresden berufen.
Hier gründete und leitete er das erste Schwachstrominstitut an einer deutschen Hochschule. Der »Vater der Schwachstromtechnik«, wie er während seiner Lehrtätigkeit in Japan genannt wurde, entdeckte den Barkhausen-Effekt in ferromagnetischen Stoffen und gemeinsam mit K. Kurz die Barkhausen-Kurz-Schwingungen.
Er führte die Maßeinheit Phon für die Lautstärke ein und förderte die Anwendung der Elektronenröhre in der Nachrichtentechnik.
Victor Klemperer
wurde am 9.10.1881 in Landsberg (Warthe) geboren. Der Literaturwissenschaftler, Romanist und Essayist hatte ab 1921 eine Professur für Romanistik an der Technischen Universität Dresden inne.
Nach 1935 wurde er als Jude aller Arbeitsmöglichkeiten beraubt, überlebte jedoch den nationalsozialistischen Terror in der Stadt. Nach 1945 übernahm Klemperer wieder eine Professur an der TU-Dresden und war 1946 erster Direktor der Volkshochschule.
Neben zahlreichen Schriften fand besonders sein Buch »LTI. Lingua Terrtii Imperii«, eine Analyse von Sprache und Denken des »Dritten Reiches«, weite Beachtung.
Klemperers Tagebücher, vor allem die der NS-Zeit, postum veröffentlicht, gelten als bedeutende Dokumente der Zeitgeschichte.
Maria Reiche
Zweifellos zählen die Erdzeichnungen in der Wüste von Nazca im Süden Perus zu den rätselhaftesten Kulturdenkmälern unserer Welt. Auf einer Fläche von 250 km² überspannt ein Netz zahlloser Linien die Geröllwüste, dazwischen gigantische, stilisierte Bilder und geometrische Zeichnungen.
Eine Frau machte dieses Rätsel in aller Welt bekannt: Maria Reiche, 1903 in Dresden geboren. In den dreißiger Jahren wanderte sie nach Peru aus. In jahrzehntelanger Arbeit entdeckte sie mehr als 40 figürliche Zeichnungen, vermaß Länge und Richtung von ca. 1000 Linien.
Sie erreichte, dass 1995 die Pampa von Nazca von der UNESCO in die Liste der Monumente des Weltkulturerbes aufgenommen wurde.
Maria Reiche verstarb 1998.
Manfred von Ardenne
Physiker, geboren am 20.1.1907 in Hamburg, gestorben am 26.5.1997 in Dresden. Ardenne leitete bis 1945 ein eigenes Laboratorium für Elektronenphysik in Berlin-Lichterfelde. Hier machte er zahlreiche Erfindungen auf dem Gebiet der Funk- und Fernsehtechnik sowie der Elektronenoptik (Rastermikroskop).
Von 1945 bis 1955 war er Leiter eines Forschungsinstitutes für industrielle Verfahren zur Isotopentrennung bei Suchumi. Danach gründete er im Dresdner Stadtteil »Weißer Hirsch« das Forschungsinstitut Manfred von Ardenne. Hier wurden unter anderem Elektronenstrahl-Mehrkammerofen und Plasmafeinstrahlbrenner entwickelt.
Ardenne machte sich darüber hinaus mit der Entwicklung der Krebs-Mehrschritt-Therapie in der Krebsforschung verdient.