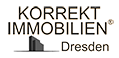|
Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/kultur/kunst-und-kultur/erinnerungskultur-regionalgeschichte/heidefriedhof.php 14.02.2025 11:43:26 Uhr 09.04.2025 00:28:25 Uhr |
|
Gedenkort Heidefriedhof
Der Heidefriedhof ist ein Ort von erinnerungskultureller Ambivalenz. In der Nachkriegszeit wurde er mit der Errichtung mehrerer Memorialanlagen zentraler Ort für das Gedenken an Opfer und Ereignisse des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Nun markiert der erste Splitter einen Erinnerungsort der NS-Diktatur im Gedenkareal Dresdner Norden.
Der Heidefriedhof ist die größte Begräbnisstätte Dresdens. Auf dem bereits 1913 von Hans Erlwein geplanten Waldstück sollte der Friedhof eine Fläche von 75 Hektar einnehmen, die jedoch für den Autobahnbau in den 1930er Jahren reduziert wurde. Die Gesamtgröße des Heidefriedhofs beträgt derzeit 30 Hektar. Und auch in seinem Charakter unterscheidet sich der zwischen 1934 und 1936 als Waldfriedhof angelegte Heidefriedhof stark von anderen Großstadtfriedhöfen.
Kriegszeiten
Mit der schrittweisen Inbetriebnahme des Heidefriedhofs ab 1936 begannen auch die Planungen zur funktionalen Erweiterung der Anlage. Im März 1939, noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, lagen Pläne für einen „Ehrenhain“ vor, der die zu erwarteten Kriegsopfer aufnehmen sollte. Im Winter 1943/44 wurden die Maßnahmen der Stadtverwaltung mit der Zunahme von Luftangriffen konkret und auf dem Heidefriedhof vier Flächen mit Reihengräbern für 10.000 Tote angelegt. Die Zahl der Todesopfer infolge der Luftangriffe zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 übertraf die Erwartungen und die Grabanlagen mussten kurzfristig erweitert werden. Die Toten wurden eng nebeneinander in ausgehobene Gräber geschichtet, die mit einer Registriernummer auf einer Holzleiste markiert wurden. Die Leichen, die bereits auf dem Dresdner Altmarkt verbrannt worden waren, wurden in einer Grube beigesetzt, die auf der zentralen Achse der Anlage ausgehoben worden war. Ein namentliches Verzeichnis der identifizierten Opfer der Bombardierungen ist im Stadtarchiv überliefert.

Massengrab der Bombentoten
Ab 1949 errichtete die Dresdner Stadtverwaltung einen „Ehrenhain für die Bombenopfer“ mit Kundgebungsplatz und Hochkreuz, der seit 1950 Ort offizieller Kranzniederlegungen zum Jahrestag der Luftangriffe wurde. Mit der Gründung der DDR wurde der Ehrenhain auf dem Heidefriedhof für die politische Propaganda im Kalten Krieg immer bedeutender: Die Luftangriffe auf Dresden wurden zum angloamerikanischen Kriegsverbrechen stilisiert. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortung während der NS-Zeit unterblieb. Zur Stärkung einer Erzählung der ungezählten zivilen Opfer wurden die markierten Einzelgräber gegen den Protest der Angehörigen aufgelöst.
Ehrenhain für die Opfer des Faschismus
Die fehlende Auseinandersetzung einer Täterschaft im Nationalsozialismus verstärkte die DDR-Führung durch das Gedenken an Angehörige des Widerstandes. Der 1955 eingeweihte „Ehrenhain für die Opfer des Faschismus (OdF)“ war Ort unterschiedlicher Gedenkveranstaltungen am „Tag der Opfer des Faschismus“ oder zu Ehren einzelner Mitglieder des Widerstandskampfes. 1961 war der Ehrenhain voll belegt. Ab 1961 folgte daher die Errichtung einer neuen Begräbnisanlage für die „Opfer des Faschismus“, die sich unmittelbar an den Ehrenhain der Luftkriegstoten anschloss.
Ehrenhain für die Kämpfer gegen den Faschismus und die Verfolgten des Naziregimes
Einen Höhepunkt und Abschluss erfuhren die Bauarbeiten im Sommer 1965 mit der Fertigstellung eines 450 Meter langen Prozessionsweges. Dieser verbindet die Grabanlage der Angehörigen des Widerstandskampfes mit den Massengräbern der Luftkriegstoten vom Februar 1945. Den Abschluss des Ehrenhains bildet eine gewölbte Gedenkmauer.
Im Zentrum umschließen 14 Stelen einen kreisrunden Kundgebungsplatz und benennen Orte des Zweiten Weltkrieges: Auf der einen Seite Namen von Konzentrationslagern – Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück, Sachsenhausen und Theresienstadt. Auf der anderen Seite Orte, die Ziele deutscher Bombardierungen oder Massaker wurden – Coventry, Leningrad, Rotterdam, Warschau, Lidice, Oradour. Und Dresden. Damit wird Dresden in dieser Erzählung als Opfer des Krieges eingereiht und mit Stätten nationalsozialistischer Kriegsverbrechen gleichgesetzt. Die heute bekannte Rolle Dresdens innerhalb des NS-Terrorregimes wird dadurch ignoriert und verharmlost. Der Heidefriedhof wurde zu einem zentralen Ort der antifaschistischen Erzählung.
Erinnerungs- und Lernort
Mit dem Ende der DDR blieben die Kranzniederlegungen zum 13. Februar die einzige offizielle Veranstaltung auf dem Heidefriedhof. Ab 2005 instrumentalisierten rechtsextreme Akteure zunehmend das Erinnern an die Luftkriegstoten und der Heidefriedhof wurde zum emotional aufgeladenen Ort, an dem um Geschichtsdeutung und Erinnerung gerungen wurde. Am Beispiel des Heidefriedhofes wird sichtbar, wie Vergangenheit zu unterschiedlichen Zeiten gedeutet, gar in Anspruch genommen wurde.
Die Landeshauptstadt Dresden und verschiedene engagierte erinnerungskulturelle Gruppen, wie MEMORARE PACEM. Gesellschaft für Friedenskultur, Denk Mal Fort! e.V. Die Erinnerungswerkstatt Dresden oder der Dresdner Geschichtsverein, gestalten das Gedenken aktiv und beschäftigen sich mit dem Heidefriedhof als Lernort der kontroversen Geschichtsdeutung.
Die genannten Initiativen veranstalteten am 16. November 2017 ein Kolloquium zum Heidefriedhof Dresden und beschäftigten sich mit dem Lernen an konflikthaften Erinnerungsorten. Die Ergebnisse liegen als Publikation vor. Im Rahmen der Ausstellung „Nachbarschaften 2025 – Eine Manufaktur der Visionen für Dresden und Europa“ fand im Kunsthaus Dresden, Städtische Galerie für Gegenwartskunst und im Dresdner Stadtraum vom 12. Mai bis 25. August 2019 eine Auseinandersetzung mit dem Heidefriedhof als Erinnerungsort statt.
Im Februar 2025 markiert der erste Splitter im Rahmen von MNEMO Gedenkareal Dresdner Norden die Dresden-Stele auf dem Heidefriedhof. Wie eine Skulptur symbolisiert der herausragende Splitter den Bruch in der Geschichtsdeutung und ein Teilstück von etwas Ganzem, das erzählt werden muss.